Hirntumor
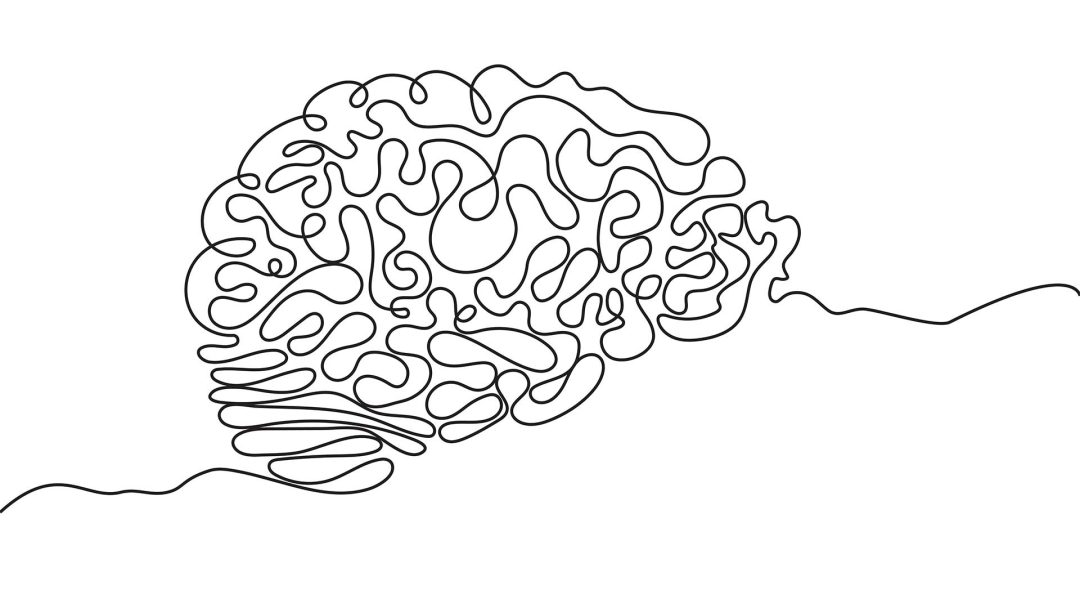
Hirntumor ist eine Sammelbezeichnung für gut- und bösartige Neubildungen, die von Geweben des Gehirns ausgehen oder aus anderen Bereichen des Körpers gestreut haben.
Aufgrund der Komplexität und Funktionsvielfalt des Gehirns kann ein Hirntumor unterschiedlichste Symptome hervorrufen und je nach Lage und Art einer sehr individuellen Behandlung bedürfen.
Die Beschwerden reichen von leichten Kopfschmerzen, über Übelkeit und Wesensveränderungen bis hin zum Aussetzen der Atmung.
Im Folgenden werden wir auf die verschiedenen Arten der Hirntumore eingehen und uns mögliche Behandlungsstrategien anschauen.
Was versteht man unter einem Hirntumor?
Ein Hirntumor, auch als Gehirntumor bezeichnet, kann sowohl eine gutartige, als auch bösartige Neubildung darstellen, die innerhalb des Schädelknochens wächst. Sie kann im Gehirngewebe selbst entstehen (primär) oder durch Metastasen aus anderen Geweben einwandern (sekundär).
Aufgrund des begrenzten Platzangebots im Schädel verdrängt der Tumor gesundes Nervengewebe und löst unterschiedlichste Symptome aus.
Die Behandlung von Gehirntumoren richtet sich massgeblich nach der Art des Tumors, individuellen Bedürfnissen und seiner Nähe zu überlebenswichtigen Strukturen.
Symptome und Anzeichen bei einem Hirntumor
Die Symptomatik eines Hirntumors hängt von seiner Lage und dem Gewebe ab, welches befallen ist.
Es können leichte Symptome, wie diffuse Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen oder Schwindel auftreten, aber auch gefährlichere Manifestationen, wie plötzliche Krampfanfälle, Lähmungen, Sprachstörungen oder Ausfälle des Seh- und Hörsinns.
Auch Gedächtnis- sowie Konzentrationsschwäche und die Änderung der Persönlichkeit sind mögliche weitere Symptome.
Gutartige und bösartige Hirntumore
Hirntumore lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Tumore.
Gutartige Hirntumoren wachsen langsam, breiten sich nicht in umliegendes Gewebe aus und lassen sich folglich leichter behandeln. Trotzdem stellen sie ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar und müssen entsprechend behandelt werden.
Bösartige Hirntumore wachsen meist schnell, breiten sich in umliegendes Gewebe aus und haben eine wesentlich schlechtere Behandlungsprognose. Ausserdem können sie metastasieren und Strukturen des gesamten Körpers befallen.
Im Folgenden schauen wir uns die wichtigsten Tumorarten einmal genauer an.
Glioblastom
Der häufigste bösartige Tumor, der dem Hirngewebe entspringt, ist das Glioblastom. Es bildet sich aus Gliazellen, genauer den Astrozyten und weist ein sehr aggressives Wachstum und eine entsprechend schlechtere Prognose auf.
Symptome überschneiden sich mit denen anderer Hirntumore, wobei das perifokale Ödem (Schwellung im umliegenden Gewebe), das der Tumor auslöst, die Beschwerden zusätzlich verstärkt.
Das typische Erkrankungsalter eines Glioblastom liegt zwischen 45 und 60 Jahren.
Zu den bisher bekannten Risikofaktoren gehören das seltene vererbte Lynch-Syndrom und das Li-Fraumeni-Syndrom, die auch als Tumorprädispositionssyndrome bezeichnet werden.
Meningeom
Meningeome sind Tumore, die den weichen Hirnhäuten entstammen und 15% aller Hirntumore ausmachen. Das übliche Erkrankungsalter liegt zwischen 40 und 60 Jahren.
Sie wachsen langsam und bleiben lange symptomfrei, was die Diagnose erschweren kann. Wenn Meningeome symptomatisch werden, zeigen sich häufig Gesichtsfeldausfälle, epileptische Anfälle oder Kopfschmerzen.
Nach gesicherter Diagnose wird eine chirurgische Entfernung angestrebt, die je nach Tumorgrad gute bis mässige Prognosen liefert.
Astrozytom
Das Astrozytom ist ein Oberbegriff für verschiedene, sowohl gut- als auch bösartige Tumore der Astrozyten, die alle Altersgruppen betreffen.
Die Symptome können je nach Grösse, Lage und Grad des Tumors variieren.
Die Prognose hängt von vielen Faktoren ab, einschliesslich des Tumorstadiums, der Lage und der ausgewählten Behandlung.
Oligodendrogliom
Das Oligodendrogliom ist ein Primärtumor, der von den Oligodendrozyten ausgeht. Das Wachstum ist häufig langsam und lokal begrenzt, es gibt aber auch Formen, die schnell wachsen und höchst maligne sind.
Typische Symptome sind epileptische Anfälle und Schlaganfall, da die Tumore häufig zur Einblutung neigen, was ein akutes Handeln unerlässlich macht. Aber auch klassische Symptome eines Hirntumors sind häufig.
Je nach Bösartigkeit, Lage und Grösse ergeben sich unterschiedlich gute Überlebensprognosen.
Ependymom
Das Ependymom ist ein Tumor, der von den Ependymzellen ausgeht. Diese kleiden die flüssigkeitsgefüllten Hohlräume des Gehirns aus, die eine wichtige Aufgabe für die Nährstoffversorgung des Gehirns tragen und durch den Tumor in ihrer Funktion eingeschränkt sein können.
Sollte der Tumor den Abfluss des Hirnwassers behindern, kommt es zu Hirndruckzeichen wie Übelkeit, Erbrechen und Unruhe. Wenn der Abfluss nicht behindert wird, bleibt der Tumor lange symptomfrei.
Hypophysenadenom
Hypophysenadenome sind gutartige Geschwüre der Hypophyse. Sie spielt eine zentrale Rolle in hormonellen Regelkreisen, weshalb sich ein Tumor in der Fehlregulation dieser Hormone zeigt.
Mögliche Symptome sind Wachstumsstörungen, Störungen des Energiehaushaltes, Erschöpfung und vieles mehr.
Bei Kompression umliegender Strukturen sind auch Sehausfälle möglich.
Akustikusneurinom
Beim Akustikusneurinom handelt es sich um eine gutartige Neubildung am 8. Hirnnerv, dem Hör- und Gleichgewichtsnerv. Entsprechend sind die Symptome Hör- und seltener Gleichgewichtsstörungen sowie Tinnitus.
Mittel der Wahl für die Therapie ist die chirurgische Entfernung. Wird das Neurinom frühzeitig erkannt, ist eine Entfernung bei Erhalt der Hörfunktion möglich.
Dermoidzyste
Dermoidzysten sind gutartige Tumore, die aus dem Embryonalgewebe hervorgehen. Sie können unter anderem im Gehirn auftreten und verursachen häufig Störungen des Gehörs, Lähmungen der Gesichtsmuskulatur oder Nervenschmerzen.
Nach erfolgreicher diagnostischer Abgrenzung zu anderen Tumoren folgt meist eine vollständige chirurgische Resektion.
Prolaktinom
Das Prolaktinom ist ein gutartiger, endokrin-aktiver, sprich hormonproduzierender Tumor des Hypophysenvorderlappens.
Bei der Symptomatik muss zwischen den Folgen der gesteigerten Prolaktinproduktion und den Symptomen durch Verdrängung der umliegenden Gewebe unterschieden werden.
Die erhöhten Prolaktinspiegel führen bei Frauen zum Ausbleiben der Periode und des Eisprungs, während es bei Männern zu Störungen der Potenz und Libidoverlust kommt.
Ausserdem kann der Tumor auf den Sehnerv drücken und zur verminderten Hormonsekretion im Rest der Hypophyse, was dann entsprechende Symptome nach sich zieht.
Nach der Sicherung der Diagnose wird meist medikamentös behandelt, um den Prolaktinspiegel zu senken. In manchen Fällen kann eine Operation notwendig sein.
Medulloblastom
Medulloblastome sind die häufigsten primären, bösartigen Hirntumore bei Kindern. Sie gehen aus den embryonalen Zellen des ZNS hervor und betreffen in den meisten Fällen das Kleinhirn.
Klassische Symptome sind Übelkeit, Koordinationsstörungen, Sehstörungen und Schläfrigkeit, die sich aufgrund des schnellen Wachstums meist früh zeigen.
Bei der konventionellen Behandlung folgt eine operative Entfernung mit anschliessender Bestrahlung zur Rezidivprophylaxe.
Infolgedessen können knapp 80% der Tumore entfernt und die Kinder vollständig geheilt werden.
Rathke Zyste
Eine Rathke-Zyste ist ein gutartiger Überrest aus der frühkindlichen Hirnentwicklung, der bei entsprechender Grösse Druck auf umliegende Strukturen ausüben kann und eine Entfernung nötig macht.
Bei entsprechender Ausprägung kann die Zyste Kopfschmerzen, Sehstörungen und hormonelle Ungleichgewichte verursachen.
Zuerst sollte sichergestellt werden, dass es sich um eine Zyste handelt und auch über einen längeren Zeitraum kein Wachstum zu beobachten ist. Anschliessend wird die Zyste operativ entfernt und die Symptomatik verschwindet.
Hirnmetastasen
Hirnmetastasen sind Krebszellen, die sich von ihrem ursprünglichen Tumor an anderer Stelle im Körper gelöst haben und sich im Gehirn ansiedeln. Sie entstehen häufig als Folge von fortgeschrittenen Krebserkrankungen in anderen Organen wie Lunge, Brust, Darm oder Haut.
Sobald sich diese Metastasen im Gehirn festsetzen, können sie Druck auf das umliegende Gewebe ausüben und zu verschiedenen neurologischen Symptomen führen, wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Krampfanfällen, motorischen Problemen oder Veränderungen im Denken und Verhalten.
Die Behandlung hängt immer von der jeweiligen Lokalisation, der Tumorart und den Bedürfnissen des Patienten ab.
Diagnostik von Hirntumoren
Die Diagnostik bedient sich einer Vielzahl von Verfahren, darunter Anamnesegespräche, Bildgebung, körperliche Untersuchung und die Bestimmung von Tumormarkern im Blut und Liquor.
Je nach Tumorart eignen sich unterschiedliche Verfahren, um sowohl die Lokalisation als auch mögliche Ausbreitung auf umliegende Strukturen zu erkennen und infolgedessen die passende Therapie zu planen.
MRT
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Veränderungen im Hirngewebe ausfindig zu machen, Volumenberechnungen anzustellen und die Durchblutung suspekter Strukturen messbar zu messen.
Zusätzlich hat es den Vorteil, dass keine Strahlenbelastung für den Patienten anfällt und selbst kleinste Veränderungen noch zuverlässiger erkannt werden, als es im CT der Fall ist.
CT
Das CT, ein Verfahren, bei dem eine Vielzahl von Röntgenbildern vom Gehirn gemacht werden, liefert ebenfalls die Möglichkeit, Tumore im Hirngewebe ausfindig zu machen und hat den Vorteil, dass Verkalkungen von Tumoren besser erkannt werden als im MRT. Daher wird es in der Regel zusätzlich zum MRT eingesetzt, wenn auch eine Strahlenbelastung für den Patienten anfällt.
Positronen-Emissions-Tomographie
Das PET ist eine weitere Bildgebung, bei der radioaktive Tracer verabreicht werden, die sich im Gehirn verteilen und in manchen Strukturen stärker anreichern als in anderen. Somit ist es möglich, Tumore ausfindig zu machen, aber auch Aussagen über den Stoffwechsel und die Bösartigkeit des Tumors zu treffen.
Es ist weniger breit verfügbar und wird daher in der Regel bei einem konkreten Verdacht hinzugezogen.
Angiographie
Die Angiographie ist ein diagnostisches Verfahren, das eine Darstellung der Gefässe ermöglicht. So lassen sich Aussagen über die Blutversorgung des Tumors treffen und wichtige Informationen für die Operationsplanung sammeln.
Da die Untersuchung jedoch mit Strahlenbelastung und auch einem Komplikationsrisiko durch die Gabe von Kontrastmittel einhergeht, wird sie nur eingesetzt, wenn eine spezielle Indikation besteht.
Liquordiagnostik
Bei der Liquordiagnostik handelt es sich um ein invasives Verfahren, bei dem mittels Punktion Hirnwasser entnommen und im Labor auf Veränderungen in der Zusammensetzung untersucht wird.
Die Liquordiagnostik kann verwendet werden, um Tumormarker, Zellen oder Blut im Liquor und erhöhten Liquordruck zu diagnostizieren. So können konkrete Aussagen über die Tumorart, den Stoffwechsel oder die Bösartigkeit getroffen werden.
Ausserdem dient es zur Abgrenzung von entzündlichen Hirnerkrankungen, die mitunter ähnliche Symptome hervorrufen können.
EEG
Das Elektroenzephalogramm (EEG) ist eine wichtige Untersuchungsmethode zur Beurteilung der elektrischen Aktivität des Gehirns. Bei Hirntumoren kann das EEG bestimmte Veränderungen in der Hirnaktivität aufzeigen, die auf das Vorhandensein eines Tumors oder auf damit verbundene epileptische Anfälle hinweisen können.
Es reicht jedoch nicht, eine definitive Diagnose zu stellen und wird immer in Kombination mit anderen Untersuchungen durchgeführt.
Behandlung eines Hirntumor
Die Behandlungsstrategie bei Hirntumoren hängt massgeblich von der Art des Tumors, der Lokalisation und dem Gesundheitszustand des Patienten ab.
Grundsätzlich ist das Ziel, den Tumor möglichst schnell und restlos zu entfernen, um Kompression auf umliegende Strukturen zu minimieren und so langfristige Schäden zu vermeiden.
Klassische Verfahren sind die operative Entfernung, Strahlen- und Chemotherapie, aber auch Hyperthermie und Photodynamische Verfahren können eingesetzt werden.
Im Folgenden schauen wir uns die verschiedenen Verfahren etwas genauer an.
Es wird empfohlen, die möglichen Therapieoptionen, im Rahmen einer umfassenden disziplinären Zusammenarbeit, zwischen Neurologen, Onkologen, Chirurgen und Ganzheitsmedizinern, zu besprechen. Dies gewährleistet eine integrative Herangehensweise, die auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist.
OP
Die von Neurochirurgen durchgeführte Entfernung eines Hirntumors erfordert genaueste Kenntnisse über die Grösse und Art des Tumors, umliegende Strukturen und versorgende Gefässe.
Wenn eine OP indiziert ist, kann der Tumor schnell reseziert werden und dabei umliegendes Gewebe geschont werden.
Strahlentherapie
Ziel der Strahlentherapie ist es, Mutationen im Tumorgewebe zu provozieren, die zum Absterben des Gewebes führen.
Sie wird entweder zur primären Behandlung eingesetzt oder vor einer Operation, um den Tumor zu verkleinern und die OP zu erleichtern.
Je nach Tumorart und Lokalisation kann die Strahlungsquelle mehr oder weniger begrenzt eingesetzt werden und kann mehrere Sitzungen über einen längeren Zeitraum erfordern. Die Nebenwirkungen sollten bei der Entscheidung unbedingt berücksichtigt werden.
Chemotherapie
Auch die Chemotherapie ist ein Verfahren, das häufig in Kombination mit OP oder Strahlentherapie eingesetzt wird, um die Prognosen zu verbessern und Metastasen zu bekämpfen.
Dabei werden je nach Tumor verschiedene Chemotherapeutika eingesetzt, die abhängig vom Individuum sehr unterschiedliche Erfolge und Nebenwirkungen erzielen können.
Photodynamische Therapie
Photodynamische Therapie ist ein Verfahren, bei dem ein Medikament verabreicht wird, das sich im Tumorgewebe anreichert und durch Laserlicht aktiviert werden kann. In seiner aktivierten Form ist es toxisch für das Tumorgewebe und provoziert ein Absterben des Tumors.
Vorteile sind die gezielte Zellzerstörung und die geringen Nebenwirkungen. Vor der Anwendung ist genauestens zu prüfen, ob die Anwendung bei dem entsprechenden Hirntumor zielführend ist.
Hyperthermie
Bei der Hyperthermie wird das Tumorgewebe erhöhten Temperaturen von bis zu 45°C ausgesetzt. Dadurch werden Krebszellen geschädigt und abgetötet, ohne dass das normale Gewebe Schaden nimmt. Die Hyperthermie wird häufig in Kombination mit anderen Krebsbehandlungen wie Chemo- und Strahlentherapie eingesetzt, um die Prognose zu optimieren.
Es ist entscheidend, dass die Hyperthermie in ein individuell angepasstes Behandlungskonzept eingebettet wird, um die bestmögliche Wirkung zu entfalten.
Weitere unterstützende Massnahmen
Bei der Entstehung eines Hirntumor kann auch ein tiefes körperliches Ungleichgewicht vorliegen. Diese ursächlichen Faktoren können ebenfalls in die Therapie einbezogen werden.
So können versteckte Stoffwechselstörungen und Mikronährstoffmängel (z.B. Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin D3) vorliegen und den Körper schwächen. Auch versteckte Entzündungen (Silent Inflammation), Immunstörungen und Darmerkrankungen können ursächliche Faktoren sein.
Methoden wie die orthomolekulare Medizin, Darmsanierung und Normalisierung des Immunsystems können die Behandlung zusätzlich unterstützen.
Lebenserwartung und Heilungschancen bei einem Hirntumor
Lebenserwartung und Heilungschancen lassen sich nicht vorhersagen, da sie je nach Tumorart erheblich variieren und stark von den ausgewählten Behandlungsmassnahmen abhängen.
Ausserdem werden Hirntumore meist spät erkannt und sind dann bereits in umliegende Gewebe eingewachsen, was eine vollständige Entfernung unmöglich macht.
Trotzdem gibt es auch gutartige Hirntumore, die vollständig heilbar sind und nach Behandlung keinerlei Symptome hinterlassen.
Um eine genauere Vorhersage zu treffen, muss der behandelnde Arzt die Tumorart weiter eingrenzen und mögliche Metastasierungen ausschliessen.
Dr. med. Karsten Ostermann M.A.
Bei einem Hirntumor können verschiedenen Behandlungsoptionen synergistisch zusammenwirken, um den Erfolg zu optimieren. Ein integrativer, individueller Ansatz mit einer umfassenden disziplinären Zusammenarbeit zwischen Neurologen, Onkologen, Chirurgen und ganzheitlichen Ärzten ist sehr empfehlenswert, um das bestmögliche Behandlungsergebnis zu erzielen.

Häufige Fragen und Antworten zu dem Thema Hirntumor.
Hirntumoren können für die Betroffenen eine erhebliche Belastung darstellen, nicht zuletzt durch die grosse Ungewissheit und die offenen Fragen, vor denen man steht.
Im Folgenden werden wir auf die häufigsten Fragen zum Thema Hirntumor eingehen.
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, sollten Sie sich an Ihren behandelnden Arzt wenden.
Die Bildgebung im MRT ist sehr komplex und je nach Einstellung zeigen sich Strukturen in unterschiedlichen Graustufen.
So können weisse Flecken auf Flüssigkeitsansammlungen hindeuten, entzündliche Veränderungen darstellen, Schlaganfall-Gewebe zeigen oder ein Hirntumor sein.
Nur erfahrene Radiologen können eine entsprechende Diagnose stellen.
Ein zuckendes Augenlied, fachsprachlich Blepharospasmus, ist ein häufig auftretendes Symptom, was in der Regel harmlos ist und durch zahlreiche Ursachen ausgelöst werden kann.
Darunter Stress, Müdigkeit, Augenbelastung und erhöhter Koffeinkonsum.
Meistens verschwindet das Symptom innerhalb weniger Stunden oder Tage und bedarf keiner weiteren Abklärung.
Sollte das Lidzucken länger bestehen oder in Kombination mit anderen neurologischen Symptomen auftreten, ist eine Abklärung ratsam.
Normalerweise ist eine Beule am Kopf kein Symptom eines Hirntumors, da Tumore unterhalb der Schädeldecke wachsen und diese nicht verdrängen können.
Trotzdem sollten beulenartige Veränderungen ohne erkennbare Ursache medizinisch abgeklärt werden, um schwerwiegende Probleme auszuschliessen.
Anzeichen können persistierende Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Taubheitsgefühle, Persönlichkeitsveränderungen und sogar Krampfanfälle sein.
Wenn eines dieser Symptome längerfristig ohne erkennbare Ursache auftritt, sollte eine ärztliche Untersuchung erfolgen.
Geschmacksstörungen können gelegentlich in Folge einer Krebsbehandlung durch Strahlen- und Chemotherapie auftreten.
Sie sind kein direktes Zeichen eines Hirntumors, sollten allerdings ärztlich untersucht werden, wenn keine Ursache erkennbar ist.
Ein Falxmeningeom ist ein Subtyp des Meningeoms, das entlang der Falx Cerebri, einer bindegewebigen Struktur zwischen den Hirnhälften, wächst.
Es kann Kopfschmerzen, Sehstörungen und andere neurologische Auffälligkeiten provozieren, die dann genauer untersucht werden sollten, um Therapieempfehlung zu finden.
In den meisten Fällen ist der Tumor gutartig und bietet gute Heilungsprognose.
Bei der Todesursache sollten verschiedene Auslöser unterschieden werden.
So kann der Tumor selbst auf wichtige Hirnareale drücken und beispielsweise einen Ausfall des Atemzentrums auslösen.
Auch können Metastasen zu lebensbedrohlichen Komplikationen in den befallenen Organen, z.B. Leber oder Lunge führen.
Weiterhin können die Nebenwirkungen verschiedener Behandlungen den Organismus schwächen und zum Tod führen.
Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jeder Hirntumor zwangsläufig zum Tod des Patienten führt und in der Regel kein plötzlicher Tod durch einen Hirntumor auftritt.
Weiterführende Informationen
Die aufgelisteten Informationen beinhalten relevante Themen und dienen dem besseren Verständnis.