Speicheldrüsenkrebs
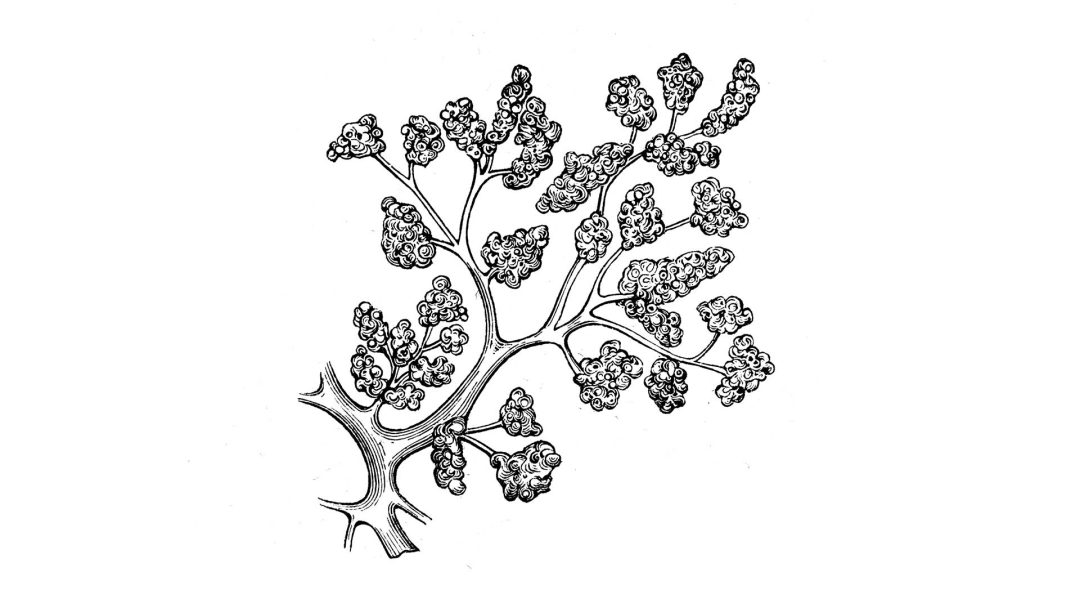
Speicheldrüsenkrebs ist eine seltene Form von Krebs, die die Speicheldrüsen betrifft. Diese Drüsen produzieren Speichel, der für die Verdauung und die Feuchtigkeitsregulierung im Mund wichtig ist.
Die Symptome sind häufig durch eine schmerzlose, fortschreitende Schwellung der Drüsen und ein Taubheitsgefühl im Gesicht (Gesichtsnervenlähmung) gekennzeichnet.
Die Therapie umfasst häufig eine Operation mit einer Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie.
Als integrative Unterstützung können auch Hyperthermie, Fiebertherapie oder Infusionstherapie zum Einsatz kommen.
Med. pract. Dana Hreus M.A.
Entscheidend für den Behandlungserfolg sind eine frühzeitige Diagnose und ein individueller, auf den Tumorstatus abgestimmter Behandlungsplan. Ganzheitliche zusätzliche unterstützende Massnahmen können, in Absprache mit dem Onkologen, eine wirksame Unterstützung bieten.

Weiterführende Informationen
Die aufgelisteten Informationen beinhalten relevante Themen und dienen dem besseren Verständnis.